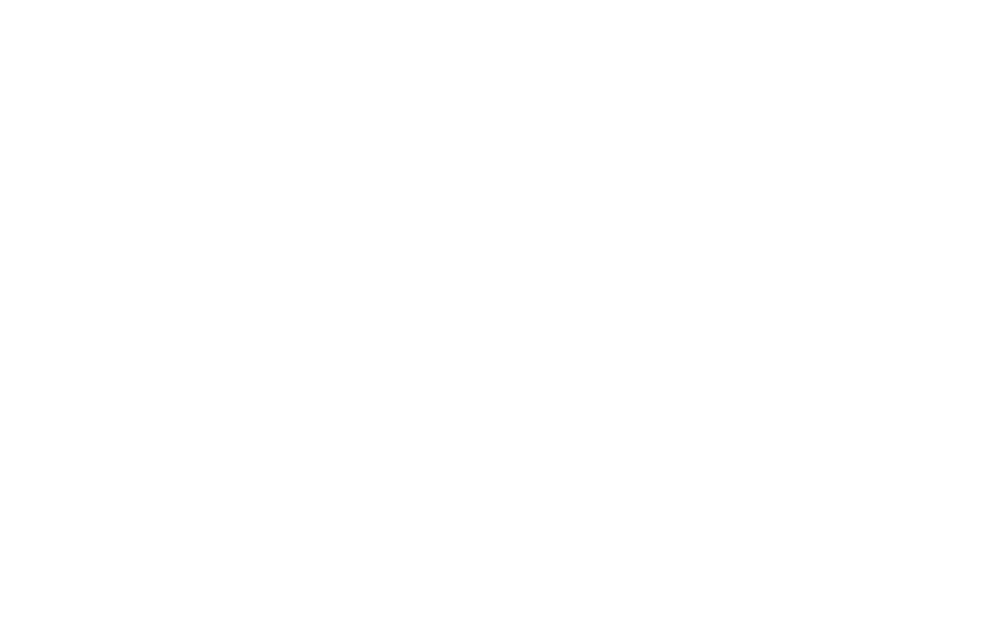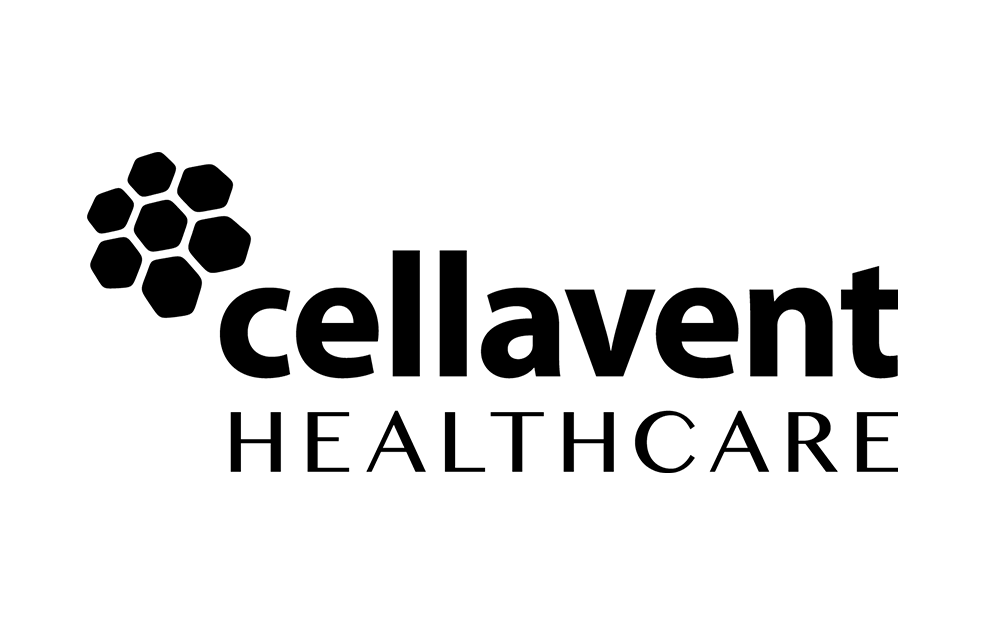Rote Bete in der Bluthochdruck-Therapie Bluthochdruck ist einer der bedeutendsten vermeidbaren Risikofaktoren für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse. Neben einer adäquaten medikamentösen Therapie spielt die Ernährung eine entscheidende Rolle in der Prävention. Eine ausgewogene Ernährung kann nicht nur beim Erreichen und Halten eines gesunden Körpergewichts unterstützen. Durch den Verzehr bestimmter Lebensmittel kann auch eine unmittelbar blutdrucksenkende Wirkung erzielt werden. Ein Lebensmittel, das aufgrund seiner nachgewiesenen hypotensiven Wirkung besonders betrachtet werden sollte, ist die rote Bete. Bedeutung von Nitrat für Gefäßfunktion und Blutdruckregulation Die blutdrucksenkende Wirkung der roten Bete wird primär auf ihren hohen Gehalt an Nitrat zurückgeführt (1). Nitrat wird im Körper zu Nitrit reduziert und anschließend in Stickstoffmonoxid umgewandelt. Dieses Stickstoffmonoxid spielt eine entscheidende Rolle in der Gefäßfunktion und Blutdruckregulation. Es wirkt gefäßerweiternd und führt auf diese Weise zu einer Senkung des Blutdrucks. Zudem verbessert es die Endothelfunktion und fördert insgesamt die kardiovaskuläre Gesundheit (2). Lange Zeit wurde eine potenzielle Toxizität von Nitrat postuliert. Diese besteht jedoch nur dann, wenn Nitrat in Nitrit und dann weiter zu Nitrosaminen umgewandelt wird. Durch Bakterien im Mund oder saure Bedingungen im Magen kann die Umwandlung von Nitrat zu Nitrit erfolgen. Nitrit kann anschließend mit Aminen im Körper reagieren und N-Nitrosamine bilden (3). Vor allem das als Konservierungsstoff verwendete Nitrat in verarbeitetem Fleisch kann potenziell krebserregende Nitrosamine bilden. Nitrat wird dadurch gerne generell als krebserregend angesehen. Diese Bedenken, hinsichtlich der krebserregenden Wirkung von Nitrat, basieren jedoch hauptsächlich auf älteren Studien, die eine hohe Methämoglobinämie bei Säuglingen aufgrund von Nitrat im Trinkwasser dokumentierten (4). Aktuelle Daten …
Arthrose-Therapie natürlich unterstützen Rund 20% der Deutschen sind von Arthrose betroffen (1). Am häufigsten handelt es sich um Gonarthrose oder Coxarthrose. Die Therapie basiert auf verschiedenen konservativen Behandlungsmethoden, sowie operativen Maßnahmen wie der Knie- und Hüft-Totalendoprothese. Aus naheliegenden Gründen begrüßen viele Patienten dabei eine konservative Therapie, welche sich jedoch mitunter schwierig gestaltet (2,3). Eine ganzheitliche Therapie im Rahmen eines angepassten Lebenswandels kann hierbei großen Einfluss auf den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität nehmen. Pathophysiologie und Therapie Typisch für degenerative Gelenkerkrankungen ist der langsam progrediente Verlauf. Am Anfang steht die Veränderung der Knorpelsubstanz, im späteren Verlauf kommt es zu Gelenkhautentzündungen oder Knochennekrosen. Es handelt sich um einen komplexen Prozess der Gelenkdestruktion, bei dem sowohl mechanische als auch immunologische Faktoren eine Rolle spielen (4). Die Therapie der Arthrose erfolgt in der Regel symptomatisch mithilfe von medikamentösen Maßnahmen und anderen Behandlungsmethoden wie Physiotherapie. Als erste Option wird meist auf topische, später dann orale NSAR zurückgegriffen. Ist die Wirkung unzureichend, so stehen noch die orale Gabe von Glucosamin oder die intraartikuläre Injektion von Corticosteroiden zur Verfügung. Bleibt auch dies erfolglos, so steht am Ende die Schmerztherapie mit Opioiden, welche jedoch nur überbrückend bis zur operativen Behandlung eingesetzt werden (sollten). Diese medikamentöse Therapie ist zwar effektiv, geht jedoch mit teils gefürchteten Nebenwirkungen wie gastrointestinale Beschwerden bis hin zur Entstehung von Ulcera einher, sodass eine minimale Dosis und möglichst kurzzeitige Einnahme angestrebt werden müssen (2,3). Ist eine Operation nicht möglich oder nicht gewünscht, kann die konservative Therapie schnell zur Herausforderung werden. Es gibt jedoch noch weitere, teils …
Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) finden vielfach Anwendung in der symptomatischen Arthrose-Therapie diese Medikamente wirken entzündungs- schmerzhemmend, sind jedoch mit zahlreichen Nebenwirkungen verbunden und nicht für die Langzeiteinnahme geeignet. Curcuminoide aus der Kurkuma-Wurzel wirken ebenfalls entzündungshemmend und wurden daher wiederholt als natürliche Alternative in der Schmerztherapie untersucht. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2023 zur Anwendung von Curcuminoiden bei Knie-Arthrose konnte zeigen: Curcuminoide reduzieren effektiv Schmerzen und die allgemeine Symptomlast bei Arthrose. Dabei sind sie nicht nur effektiver als ein Placebo, sondern zeigen auch eine vergleichbar gute Wirkung wie NSAR. Der entscheidende Unterschied: Curcuminoide allein, oder in Kombination mit NSAR gehen mit deutlich weniger Nebenwirkungen einher. Das macht Kurkuma-Extrakte zu einer vielversprechenden Alternative in der Arthrose-Therapie. Zhao, J., Liang, G., Zhou, G., Hong, K., Yang, W., Liu, J., & Zeng, L. (2024). Efficacy and safety of curcumin therapy for knee osteoarthritis: A Bayesian network meta-analysis. Journal of ethnopharmacology, 321, 117493. https://doi.org/10.1016/j.jep.2023.117493
Indikations-optimierte Kurkuma-Präparate für die therapeutische Anwendung Kurkuma und Curcumin gelten als etablierte Wirkstoffe im Rahmen ganzheitlicher und komplementärer Therapiekonzepte. Dabei sind sowohl Anwendungsgebiete als auch Darreichungsformen vielfältig und werden stetig zahlreicher. Gleichzeit steigt der Anspruch Therapieentscheidungen an individuellen Bedürfnissen, Ressourcen und Risiken der Patienten auszurichten. Das kann zu Verunsicherung führen. Die Cellavent Healthcare hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, mit der Marke Acurmin®, zielgerichtete, therapeutische Kurkuma-Präparate für verschiedene Indikationen und Patientenbedürfnisse zu entwickeln. Kurkuma ist seit Jahrtausenden fester Bestandteil der traditionellen, asiatischen Medizin. Spätestens seit den 1990er Jahren war Kurkuma mit seinem Hauptwirkstoff Curcumin zusätzlich Gegenstand von mindestens 20.000 wissenschaftlichen Publikationen (National Library of Medicine, Stand: 16.01.2024). Diverse Meta-Analysen bestätigen dabei die positive Wirkung von Curcumin auf Blutfettwerte (1), Blutzuckerregulation (2), Entzündungsmarker (3,4), Blutdruck (5) und Gefäßfunktion (6). Ein zugleich geringes Nebenwirkungsprofil (7) macht Kurkuma zu einer sinnvollen Maßnahme im Rahmen eines ganzheitlichen Therapiekonzeptes. Die Bioverfügbarkeit: Zentrale Hürde in der Therapie Ein limitierender Faktor bei Kurkuma-Extrakt ist die geringe Bioverfügbarkeit des Curcumins. Der lipophile Charakter des Pigments, gepaart mit einer schnellen Metabolisierung bedingt, dass nach Einnahme von reinem Kurkuma-Extrakt nur verschwindend geringe Konzentrationen im Blut nachgewiesen werden (8). Die Konsequenz ist, dass in klinischen Studien hohe Dosierungen zur Anwendung kommen mussten. Und selbst dann bleibt fraglich, ob und inwieweit das Curcumin wirklich aufgenommen wird. Letztlich können auch indirekte, gastrointestinale Mechanismen, wie die Beeinflussung des Mikrobioms, systemische Effekte induzieren (9). Gerade im Hinblick auf schwer zu erreichende Körperregionen bleibt die Bioverfügbarkeit jedoch ein zentrales Problem. Optimierte Pharmakokinetik mit mizellarem Curcumin …
Mit Sauerkirschsaft-Konzentrat Gichttherapie ergänzen Montmorency-Sauerkirschen, insbesondere daraus gewonnenes Konzentrat, können begleitend zur medikamentösen Therapie von Gicht angewandt werden. Die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe fördern die Ausscheidung von Harnsäure, senken den Harnsäurespiegel und reduzieren effektiv das Risiko für akute Gichtanfälle. Patienten mit Gichterkrankungen leiden häufig unter schmerzhaften Gelenkentzündungen, die sich in einem schubartigen Verlauf zeigen. Sie sind Folge einer vermehrten Ausfällung von Harnsäure als Uratkristalle (1). Vom Immunsystem als Fremdkörper in den Gelenken identifiziert, induzieren diese Kristalle schmerzhafte Entzündungsreaktionen (1,2). Harnsäure ist ein natürliches Endprodukt des Purinmetabolismus. Im Rahmen ständiger Auf- und Abbauprozesse, sowie durch die tägliche Nahrungsaufnahme, fällt Purin als Metabolit des genetischen Materials an. Zu Harnsäure verstoffwechselt, kann diese dann über den Urin ausgeschieden werden (2). Abhängig von der individuellen Ausscheidungsrate, dem Aufkommen im Stoffwechsel und der Zufuhr über die Nahrung kann es jedoch zu einem Anstieg des Harnsäurespiegels kommen. Ein langfristig erhöhter Wert – auch als Hyperurikämie bezeichnet – kann das Risiko für Gicht und andere Harnsäurebedingte Erkrankungen steigern. Ein asymptomatisch erhöhter Harnsäurespiegel bedingt jedoch nur in wenigen Patienten auch wirklich einen Gichtanfall. Daher spricht man erst bei wiederkehrender Symptomatik von einer Gichterkrankung. Als typische Lokalisation von Gichtanfällen gelten das Großzehengrundgelenk, sowie allgemein die Füße und Hände (1). Begünstigende Faktoren für die Entstehung einer Gichterkrankung umfassen Übergewicht, eine genetische Prädisposition, Alkoholkonsum, sowie den Verzehr von Fleisch, Innereien und zucker-gesüßten Getränke. Niedrige Außentemperaturen können Anfälle zusätzlich kurzfristig begünstigen (1). Neben einer symptomatischen Therapie mit schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten, kommen vor allem Urikostatika zur Hemmung der körpereigenen Harnsäure-Synthese zum Einsatz. Zusätzlich …
- 1
- 2